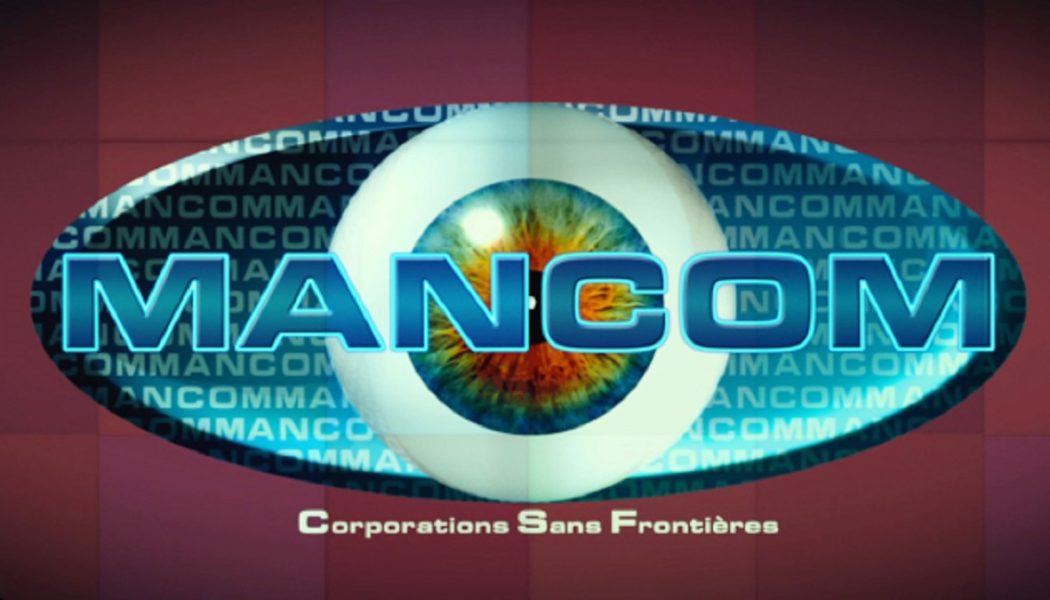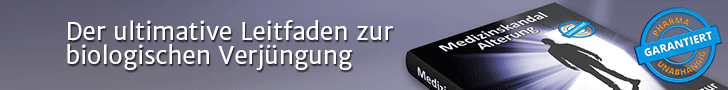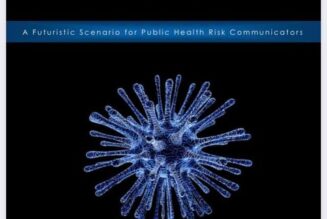Filme, die eine rein freimaurerische Idee vermitteln, sind zuweilen sehr anstrengend. Das normale Publikum, welches die okkulte Bildsprache nicht zu deuten weiß, dürfte kaum einen Sinn in dem Gezeigten erkennen. „Zero Theorem“ aus dem Jahr 2013 ist solch ein Film, der keinen Bezug zur Lebensrealität der Menschen hat. Er zeigt eine Dystopie, welche zu bizarr ist, um sich darin hineinzuversetzen.
Im Zentrum dessen, was wohl eine Handlung darstellen soll, steht der glatzköpfige Qohen (Christoph Waltz), der von sich selbst in der ersten Form Plural zu sprechen pflegt. Ob dies ein Anzeichen einer multiplen Persönlichkeitsstörung sein soll, wird nicht ganz klar. Gestört ist er aber auf jeden Fall, genauso wie all seine Mitmenschen.
Qohen lebt in einer heruntergekommenen Kirche, die Gott schon vor sehr langer Zeit verlassen hat. Erbaut wurde sie jedenfalls von Freimaurern, denn schon in der Eröffnungsszene sieht man den ersten Schachbrettboden. Im Prinzip spielt sich ein Großteil von Qohens Leben auf dem Schachbrett der Loge ab, auf dem er allerdings nur ein jämmerlicher Bauer ist.
Seine Heimat ist offensichtlich London, wie man an den Bussen unschwer erkennen kann. In der Realität haben diese jedoch keine Schachbrettmuster an den Ecken. Auffällig ist außerdem die Werbeanzeige an der Front. Dort ist ein blonder Politiker zu sehen, der große Ähnlichkeit mit Boris Johnson aufweist. Da der Film in einer dystopischen Zukunft angesiedelt ist und Johnson erst sechs Jahre nach Erscheinen des Films zum Premierminister Großbritanniens gewählt wurde, könnte es sich hierbei um eine versteckte Ankündigung handeln.
In dieser grauenhaften Zukunft arbeitet Qohen für eine IT-Firma namens Mancom. Deren Logo ist ein allsehendes Auge.
Passend dazu hängen überall im Firmengebäude Poster mit der Aufschrift „Alles ist unter Kontrolle“. Unter totaler Kontrolle, um genau zu sein.
Vom Chef (Matt Damon), der sich schlicht Management nennt, erwartet Qohen eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn seines Lebens. Stattdessen erhält er auf einer kruden Party aber nur nutzlose Kommentare von seinem Boss. Dieser trägt stets schwarz/weiße Klamotten, die dem jeweiligen Hintergrund angepasst sind. Außerdem hat er die Gabe, sich in kürzester Zeit umziehen zu können.
Qohens Aufgabe bei Mancom ist es, Entitäten zu knacken. Wobei Entitäten eigentlich der falsche Begriff ist, da es sich um mathematische Formeln handelt. Die Daten laufen in einer unterirdischen Zentrale zusammen, deren Portal mit Sonnensymbolen geschmückt ist. Diese werden zum Ende noch eine Rolle spielen.
Der Komplex ist wenig einladend und das Domizil des Praktikanten Bob (Lucas Hedges), der seinerseits alle Menschen Bob nennt.
An den Seiten des Zentralkerns befinden sich Datenzuflüsse, die mit achtzackigen Sternen verziert sind.
In der virtuellen Welt, in der Qohen die mathematischen Formeln zusammensetzen muss, ist dagegen alles kubisch. Behauene Steine für bekloppte Angestellte.
Nachdem die Arbeit im Firmensitz nicht so recht voran geht, wird dem Glatzkopf die Heimarbeit gestattet. Dort kann er die Kuben wenigstens auf dem freimaurerischen Schachbrett sortieren.
Bewacht wird er dabei von zwei weißen Venustauben.
Nachts träumt Qohen stets von einem schwarzen Loch, was sein inhaltsleeres Leben gut auf den Punkt bringt.
Zuweilen bekommt er Besuch von durchgeknallten Leuten, darunter eine als Krankenschwester verkleidete Frau, die ihn erst anbaggert, dann aber einen Rückzieher macht.
Noch verrückter ist ein Vorgesetzter, der zuweilen einen Zwerg als Verstärkung dabei hat.
Die Krankenschwester taucht später noch einmal als Lady in Rot auf und vermacht Qohen einen Cyberanzug, mit dem er virtuelle Welten aufsuchen kann. Bainsley (MélanieThierry) stellt offensichtlich eine Verführung für ihn dar und passend dazu gibt es im Hintergrund ein teuflisches Hexagramm. Als Davidstern lässt es sich hier jedenfalls nicht deuten, da das Gebäude wie bereits erwähnt eine Kirche ist und keine Synagoge.
Bevor Qohen sich auf die virtuelle Ebene einlässt, gibt es erst einmal Pizza. Geliefert wird sie von einem halbnackten Busenwunder, der Bob unentwegt auf die Titten starrt.
Qohen hat derweil nur Augen für Bainsley, mit der er sich auf einer virtuellen Insel im Cyberspace trifft. Die Champusflasche ist dabei ziemlich eindeutig als Phallussymbol gedacht.
Da Bainsley jedoch keinen Cybersex mit dem Entitätenknacker haben will, sucht dieser später einschlägige Pornoportale auf. Ab hier dreht sich eigentlich alles nur noch um Sex, mit dem Qohen sein inhaltsloses Leben auszufüllen versucht.
Der Schachbrettboden ist auch in der Pornowelt nicht weit, sodass das Ganze schon fast einen rituellen Charakter bekommt.
Ficken bis der Arzt kommt, das dachten sich wohl auch die Besucher eines Sex-Shops, vor dem ein Krankenwagen parkt. Bestimmt ein akuter Anfall von Tripper.
Aber was soll man auch anderes in einer Welt machen, in der sonst alles verboten ist? Die Verbotsschilder sind übrigens zu einem X angeordnet, was wohl auf das Rating anspielt.
Qohen unterhält sich auf diesem öffentlichen Platz gerade mit einem Kollegen über sein fortgeschrittenes Alter, als er vom Tod erschreckt wird. Okkulte Symbolik kann zuweilen recht zynisch sein.
Letztendlich versucht Qohen, aus seinem Hamsterrad auszubrechen und zerstört als erstes die zahllosen Kameras in seiner Kirche. Eine ist anstelle eines Kopfes auf die Schultern von Jesus montiert, womit hier aber sicher nicht das allsehende Auge Gottes gemeint ist, sondern das des Arbeitgebers.
Nachdem Qohen eine Ewigkeit auf den Anruf seines Chefs gewartet und dabei seine Lebenszeit vertrödelt hat, konfrontiert er ihn schließlich in der Zentrale direkt mit der alles entscheidenden Frage. Doch Management erfüllt ihm nicht den Wunsch nach einem Lebenssinn.
Qohen zerstört daraufhin den Datenkern, der sich jedoch selbst umgehend wieder repariert, nur um schlussendlich doch wieder in die Luft zu fliegen.
Nach dem Sinn all dessen sollte lieber nicht gefragt werden, da alles so sinnlos ist wie Qohens Leben. Warum sich also Gedanken darüber machen, dass im Innern der Maschine ein schwarzes Loch lauert, welches alle eingespeisten Lebensdaten verschlingt? Sicher, das ist Symbolsprache, aber der Realismus hat sich gleichermaßen längst ins schwarze Loch verabschiedet.
Als Zugabe springt schließlich auch Qohen ins Loch. Überraschenderweise landet er dadurch auf der idyllischen Insel im Cyberspace. Dort steht er nackt am Strand herum und streichelt die Sonne. War ja klar, dass wieder einmal alles auf eine freimaurerische Erleuchtungsgeschichte hinausläuft.
Fazit: “The Zero Theorem“ ist von vorne bis hinten gequirlte Scheiße. Zwar verbirgt sich hinter der skurrilen Fassade eine freimaurerische Gedankenwelt, diese wird jedoch in derart obskuren Farben gemalt, dass man es als vernunftbegabter Zuschauer kaum aushält. Man fühlt sich danach absolut nicht erleuchtet, sondern eher hinters Licht geführt. Lediglich Fans von abstrakter Kunst kommen hier auf ihre Kosten, sofern sie denn Meister vom Stuhlgang sind.