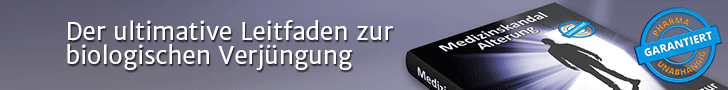Der Film „Rottet die Bestien aus!“ von Raoul Peck erzählt die Verbrechensgeschichte des Westens. Dabei schert er sich nicht um die Unterschiede zwischen Kolonialismus und Judenvernichtung.
Drei Wörter, sagt Filmemacher Raoul Peck, fassen die gesamte Historie der Menschheit zusammen: Zivilisation, Kolonisation und Vernichtung. Kurz danach sagt er, ein einziger Satz fasse die Geschichte der westlichen Welt und des europäische Kontinent zusammen. Er stammt aus Joseph Conrads „Herz der Finsternis“, wird dort von einem Kolonialverbrecher gesagt und lautet „Rottet die Bestien aus!“. Peck versucht beides mit seinem heute auf Arte zu sehenden Dokumentarfilm gleichen Namens zu belegen.
Er beginnt mit der nachgestellten Erschießung einer Sprecherin der Seminolen durch einen amerikanischen Soldaten aus der Armee Andrew Jacksons. Die Seminolen, ein Indianerstamm aus dem nördlichen Florida, der erst im achtzehnten Jahrhundert entstanden war, hatten flüchtige schwarze Sklaven aufgenommen, deren Herausgabe die weißen Amerikaner verlangten. Nachdem Florida 1821 von den Spaniern an die Vereinigten Staaten übergegangen war, kam es zum Krieg.
Dazu stellt Peck einen Ausschnitt aus dem Musical „On the Town“ von 1949. Hier tanzen unter Führung von Gene Kelly drei Matrosen samt weiblicher Begleitung durch ein New Yorker Museum für Anthropologie, um sich – „Sie hatten keinen Bebop, sondern Tomtoms“ – über Ureinwohner und Urmenschen lustig zu machen. Es folgt der mit Bildern aus Stockholm illustrierte Hinweis auf eine Gruppe schwedischer Rechtsradikaler, die 1991 verkündet hatte, „alle Juden und Neger“ müssten sterben. Fünfundzwanzig Jahre später machte ein schwedisches Kaufhaus einen neunjährigen dunkelhäutigen Jungen zum Zentrum seiner Weihnachtsreklame und erntete rassistische Kommentare. Es folgt im Film eine Montage von Fackelzügen, Schlägereien sowie gewalttätigen Phrasen nationalsozialistischer und fremdenfeindlicher Bewegungen samt einer Sequenz mit amerikanischen Präsidenten, die Größe ihres Landes beschwörend.
Ein blutiger Teppich
Das sind die ersten fünfzehn Minuten des Films. So geht es vier Stunden lang. Gespielte Episoden, historische Filmszenen, Schnipsel aus Nachrichtensendungen oder Hetzreden, volkshochschulhafte Informationen und geschichtsphilosophische Sentenzen des Autors wechseln einander ab. Es wird aus der Geschichte des Völkerhasses wie der Genozide erzählt. Und zwar wird sie in Form eines blutüberströmten Teppichs ausgerollt, in den alle staatlichen Gewaltverbrechen des Westens eingewoben sind und in dem sie ineinander übergehen: der Kongo unter belgischer Grausamkeit, Hiroshima und Nagasaki, die Ostindischen Kompagnien, Donald Trumps Satz, die Immigranten aus Mexiko seien keine Menschen, sondern Tiere, die kolonialen Grausamkeiten, die den Rohstoffraub seit dem sechzehnten Jahrhundert begleiteten, die christlichen Kreuzzüge, Ruanda und Saigon, die katholische Inquisition, die den Begriff des „unreinen Blutes“ aufgebracht habe.
Für Peck hängen all diese Ereignisse zusammen. Das ist schon deshalb so, weil er sich für ihre Besonderheiten weniger interessiert, auch wenn gleich zu Beginn bekundet wird, alle seien einzigartig. Kurz darauf folgt der Satz: „Die Bilder sehen immer gleich aus.“ Sollte das so sein – es waren gerade die Brillen- und Schuhberge von Auschwitz und ähnliche Haufen aus Ruanda gezeigt worden –, könnte es gegen Bilder sprechen. Es geht dem Film um westliche Verbrechen. Wenn sie gleichwohl von Mobutu, Duvalier oder den Hutu begangen worden sind, wenn „weiße Überlegenheit“ also kein Motiv gewesen sein kann, zeigt er entweder Bilder von Staatsbesuchern aus dem Westen, die den Gewalttätern an Geschäften interessiert begegneten. Oder wir sehen, wie Barack Obama und Hilary Clinton die Erschießung des Terroristen durch amerikanische Soldaten verfolgen, als sei darin das eigentliche Böse zu finden. Wenn auch das nicht möglich ist, ereilt den Westen die Anklage, er habe nicht geholfen, wie im Fall der ruandischen Massaker.