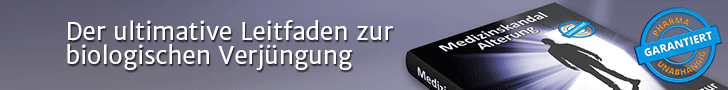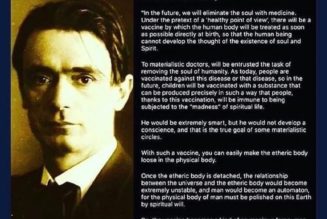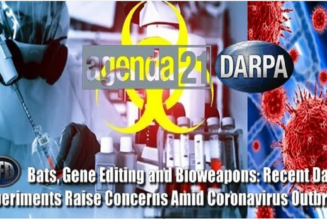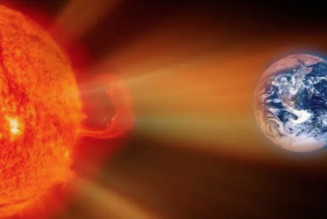Digitaler Euro und die Zukunft des Bargelds
Jeder hat sich daran gewöhnt: Das Gehalt landet auf dem Bankkonto und mit dem Guthaben können Rechnungen überwiesen und Einkäufe im Laden getätigt werden. Doch geht die Bank pleite, steht der Bürger mit leeren Händen da. Er ist dann nur einer unter vielen Gläubigern, der seine Ansprüche anmeldet. Zwar zahlen die Banken nach staatlicher Vorgabe in einen Einlagensicherungsfonds, damit Bankkunden im Insolvenzfall bis zu 100.000 Euro Entschädigung erhalten. Doch ob dieser Topf in einem größeren Krisenfall ausreicht, weiß der Kunde nicht.
Anders liegen die Dinge beim geplanten staatlichen digitalen Euro, kurz E-Euro. Der würde zwar ebenfalls über die Server der Banken fließen, doch verwahren ihn die Geldinstitute lediglich im Auftrag des Bürgers, vergleichbar mit Wertgegenständen in einem Bankschließfach. Der E-Euro steht nicht in der Bilanz der Bank. Wird die Bank also insolvent, kann der Bürger seine E-Euros immer noch zu einer anderen Bank transferieren – anders als beim heutigen Giralgeld.
Bargeld ist ebenso wenig insolvenzgefährdet. Aber kann man den E-Euro mit Bargeld vergleichen? Der Entwurf der EU-Kommission zu einem digitalen Euro stammt vom 28. Juni 2023. Der Gesetzesvorschlag wird von den Regierungen der EU-Staaten und vom EU-Parlament diskutiert. Sowohl die Abgeordneten in Straßburg und Brüssel als auch die nationalen Finanzminister im EU-Ministerrat können Änderungen vorschlagen und beschließen. Der Weg zur fertigen Verordnung ist noch lang: Die Beratungen im Währungsausschuss des neu gewählten EU-Parlaments beginnen von vorn.
Die Zweifel am Projekt scheinen groß zu sein: In einer Resolution vom 11. Februar 2025 fordert das Parlament die Europäische Zentralbank auf, die Vorteile eines digitalen Euros nachvollziehbar zu machen. Das Bundesfinanzministerium wiederum gibt keine Auskünfte über den Stand der Diskussion im Ministerrat. Einem Bericht zufolge ist vor Juli 2025 mit keinen Fortschritten zu rechnen. Im Folgenden soll der digitale Euro daher auf Basis des Entwurfs der EU-Kommission betrachtet werden:
Wer den E-Euro nutzen möchte, muss sich an seine Bank wenden. Sobald das E-Euro-Konto eingerichtet ist, kann man sich digitale Euros vom Girokonto auszahlen lassen. Zugang zum Konto gibt es über eine Smartphone-App oder eine Webanwendung für PC-Nutzer. Die meisten Läden werden den elektronischen Euro akzeptieren, auch sämtliche Shops im Internet oder Onlinebuchungsportale. Wenn ein Unternehmen den E-Euro ablehnt, droht eine Strafe. Ausnahmen davon gelten nur dort, wo ein Geschäft gar kein elektronisches Zahlungsmittel an der Kasse akzeptiert und zugleich weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigt und unter zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet.
Nach Multipolar-Informationen hat die Bundesregierung gegen diesen E-Euro-Annahmezwang keine Einwände. Für natürliche Personen – also Menschen, nicht GmbHs oder Vereine – wären Zahlungen mit dem digitalen Euro und auch die Kontoführung grundsätzlich kostenlos, denn Händler dürfen von E-Euro-Nutzern keinen Aufschlag verlangen und Banken keine Gebühren erheben – Letzteres ein Aspekt, der in der Finanzbranche auf Missfallen stößt.
Da die E-Euros von den Geldinstituten verwaltet werden, gibt es Einschränkungen bei der Privatsphäre. Die Bank sieht, wer wem wie viel schickt. Bei Geldwäscheverdacht muss die Bank das dem Finanzministerium melden. Allerdings soll der Bürger gewisse Beträge auch unter eigener Verwaltung auf dem Smartphone halten können. Fabio Panetta, bis dato Mitglied des Vorstands der Europäischen Zentralbank (EZB), nannte im November 2022 eine Grenze von 50 Euro für anonyme Transaktionen. Das selbst verwaltete Geld ließe sich dann abseits von Staat und Banken direkt von Smartphone zu Smartphone transferieren. Zumindest bis die 50 Euro aufgebraucht sind, wäre auch das Bezahlen im Einzelhandel weiter möglich, etwa wenn eine Softwarestörung die Kartenbezahlsysteme lahmlegt.
Da die E-Euros vor Verlust durch Bankeninsolvenz geschützt sind, dürften viele Bürger ihr Vermögen lieber in digitalen Euros halten wollen, anstatt es riskant einer Bank zu leihen. Doch dem will der Gesetzgeber einen Riegel vorschieben. Laut Bundesbank müssen Privatbürger mit einer Haltegrenze zwischen 500 und 3000 Euro rechnen. Da kann es schnell passieren, dass das E-Euro-Portemonnaie überläuft. Erhält ein Bürger mehr Geld, als sein Schließfach fassen kann, wird der Überschuss automatisch vom gewöhnlichen Bankkonto aufgefangen. Für Unternehmen, heißt es aus Bundesbankkreisen, ist inzwischen eine Haltegrenze von null Euro angedacht.
Nach wie vor leben Millionen Menschen außerhalb des digitalen Finanzsystems, ohne Konto. Der elektronische Euro soll auch ihnen zur Verfügung stehen, sofern das Konto für private Zwecke genutzt wird. Menschen ohne Bankkonto bekämen die Möglichkeit, zumindest auf Behörden oder Postämtern Zahlungen in Auftrag zu geben. Laut Bundesbank ist auch eine aufladbare Geldkarte angedacht. Unternehmer – und zum Beispiel auch Betreiber oppositioneller Medien – erhalten nur dann ein E-Euro-Konto, wenn sie Kunde einer gewöhnlichen Bank sind. Einen Vorteil gibt es aber für sie: Kündigt das Geldinstitut die Geschäftsbeziehung, wie es Regierungskritikern immer öfter widerfährt, bleibt die E-Euro-Kontonummer erhalten. Zumindest dann, wenn der Betroffene rechtzeitig eine andere Bank findet.
Welche Ideen hinter dem E-Euro stecken
Einst dienten Münzen aus Gold und Silber als Zahlungsmittel, dann kam Papiergeld. Der Besitzer hatte das Recht, die Scheine auf der Bank in Münzen einzutauschen. Heute bringt der Staat fälschungssicheres Geld aus wertlosen Materialien in Umlauf: die Euro-Scheine und -Kupfermünzen. Und wird er morgen nur noch elektronische Euros anbieten, die sich dem Zugriff des Besitzers entziehen, sobald die anonyme Macht digitaler Systeme ihren Dienst versagt?
Für Bundesbankpräsident Joachim Nagel ist der E-Euro „eine weitere Stufe der Entwicklung des staatlichen Geldes – nach Münzen und Banknoten“. Aber wie alle anderen staatlichen Vertreter in Europa betont auch er, dass das Bargeld bleiben werde und lediglich von einem elektronischen Zwilling Verstärkung bekomme.
Die EZB begründet die Notwendigkeit eines digitalen Euro schon lange mit dem Trend zum digitalen Bezahlen. Wenn der Bürger nicht mehr wahrnehme, dass es ein überall nutzbares insolvenzsicheres staatliches Geld gibt, das ebenso gut verwendet werden kann wie private Zahlungsmittel auf Basis von Krediten und Bankguthaben (Girocard, Kreditkarte), dann leide das öffentliche Vertrauen in die Banken, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Mit der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels gewinnt diese Überlegung an Aktualität, auch angesichts der zunehmenden Ablehnung von Bargeld bei Behörden, Hotels oder im Nahverkehr, während zugleich mehr und mehr Möglichkeiten verschwinden, Bargeld vom Konto abzuheben.
Die Diskussion um das Vertrauen ins Bankensystem lässt vermuten, dass die EZB zweifelt, ob Bargeld seine Rolle als Zahlungsmittel behalten wird. In ihrem ersten Bericht zum digitalen Euro von 2020 schrieb die EZB in einer Fußnote: „Die Unterhaltungskosten der Bargeldinfrastruktur im Verhältnis zur Zahl der Barzahlungen könnten über ein akzeptables Maß hinaus ansteigen und den Rückgang der Verfügbarkeit und Akzeptanz von Bargeld beschleunigen.“ Die Kosten auf die einzelne Barzahlung heruntergerechnet nehmen dann zu, wenn immer weniger Menschen Bargeld nutzen.
Inzwischen sind von der EZB viele Argumente für den digitalen Euro zu vernehmen: Der Bürger hätte die Möglichkeit, immer kostenlos zu bezahlen. Die kleinen Händler würden entlastet, weil die Gebührenlast für digitale Zahlungen sinkt. Menschen ohne Bankkonto könnten am Zahlungsverkehr teilnehmen. Und in Europa ansässige Banken hätten auch einen Vorteil, weil Onlinehändler den digitalen Euro akzeptieren müssten, denn die Bank bekommt vom Händler Gebühren für E-Euro-Transaktionen, während sie an Paypal- und Google-Pay-Zahlungen gar nichts verdient. Ein starkes Motiv ist die Unabhängigkeit von den US-Zahlungsdienstleistern Mastercard und Visa. Ihr Marktanteil liegt im Euroraum bei über 60 Prozent. Nur einige Länder besitzen ein eigenes, von nationalen Banken getragenes Zahlungssystem: So gibt es in Deutschland die Girocard.
Die im letzten Absatz genannten Ziele haben gemeinsam, dass sie sich auch mit einem europäischen Zahlungssystem auf Basis von Bankguthaben verwirklichen ließen. Man würde per Gesetz eine Zahlungsplattform schaffen, an der sich dann alle in Europa ansässigen Banken und Zahlungsdienstleister zu beteiligen hätten. Der Bürger hätte kostenlosen Zugang, die Gebühren für Unternehmen wären begrenzt und der Handel müsste das Zahlungsmittel akzeptieren.
Ein von den Geldinstituten unabhängiges digitales Geldschließfach auf dem Smartphone wäre allerdings nicht auf Basis von Bankguthaben umsetzbar. Hauptargument für eine solche Möglichkeit ist der Datenschutz. Das mag verwundern, weil die EU-Kommission anonymen Zahlungen gegenüber skeptisch eingestellt ist. Doch gerade sie dürfte sich aus langfristigen Erwägungen heraus etwas vom „Smartphone-Konto“ versprechen: Wie der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring in einem Artikel darlegte, kann der digitale Euro so gestaltet werden, dass der Kunde Kleinbeträge ohne staatliche Aufsicht ausgeben kann, während Einzelhändler gezwungen wären, E-Euro-Zahlungen so entgegenzunehmen, dass der Fiskus automatisch über die Einnahmen informiert ist. Die EU-Kommission hat immer wieder Anstrengungen unternommen, den Bürger zur Nutzung nachverfolgbarer, elektronischer Zahlungsmittel zu bewegen. Zuletzt verzichtete die italienische Regierung Meloni unter dem Druck Brüssels darauf, die Annahmepflicht für Kartenzahlungen im Einzelhandel zu lockern. Mit dem E-Euro hätte die EU-Kommission ein neues Mittel, Barzahler zur Nutzung von digitalem Geld zu bringen.
Vor- und Nachteile des E-Euro für Bargeld
Verschafft der E-Euro Bargeld einen Vorteil? Nach den Plänen der EU-Kommission soll es möglich sein, das bankverwaltete E-Euro-Konto nicht nur zu befüllen, indem man Bankguthaben in digitale Euros verwandelt. Stattdessen ginge das auch direkt mit Bargeld: Am Bankautomat könnten Scheine in E-Euros oder E-Euros in Scheine umgetauscht werden. Nach Ansicht des Europäischen Verbraucherschutzverbands BEUC würde das den Zugang zu Bargeld verbessern, da die unabdingbare, aber gefährdete Infrastruktur des Bargelds, also Geldautomaten und Bankfilialen, eine weitere Aufgabe zu erfüllen hätte.
Doch dieser Bedeutungszuwachs hilft nur, soweit er den EU-Gesetzgeber dazu bringt, eine Mindestversorgung mit Bargeld sicherzustellen. Andernfalls ziehen sich die Geldinstitute immer weiter zurück. Nach Untersuchung der Bundesbank empfinden mittlerweile 15 Prozent der Bundesbürger den Zugang zu Bargeld als schwierig oder sehr schwierig – ein Anstieg um neun Prozentpunkte seit 2021. Zwischen 2017 und 2023 machte jede dritte Bankfiliale dicht und immer mehr Geldautomaten verschwinden.
Ein klarer Nutzen ergäbe sich, wenn die Umwandlung von E-Euros in Bargeld an allen Geldautomaten für alle Bürger kostenlos möglich wäre. Dann hätte die Gesellschaft wieder flächendeckenden gebührenfreien Zugang zu Bargeld. Im Gesetzesentwurf heißt es, dass der Abfluss von E-Euros in Papiergeld kostenfrei anzubieten ist. Doch auf Multipolar-Anfrage kommt die Bundesbank zu der Prognose, dass die Umwandlung in Bargeld am Ende lediglich an den Automaten der kontoführenden Bank funktioniert. Denn dies dürfte, so die Bundesbank, „aus Sicherheits- oder regulatorischen Gründen bevorzugt werden“.
Leichtere Bekämpfung des Bargelds
Dazu kommt die Kehrseite. Wie geschildert gäbe es mit dem digitalen Euro neben Bargeld ein weiteres kostenloses staatliches Zahlungsmittel. Weil der E-Euro zugleich fast überall akzeptiert und für jeden verfügbar wäre, würde es dem Staat fortan leichter fallen, die Bargeldnutzung zu beschränken. Denn für Menschen ohne Bankkonto steht dann ja ein alternatives Zahlungsmittel bereit. In Griechenland lässt sich heute ein Laptop oder eine mittelgroße Hotelrechnung nicht mehr mit Bargeld bezahlen: ab 500 Euro drohen Strafen. Und wenn es weniger Menschen gibt, die zwingend auf Bargeld angewiesen sind, lässt sich auch der Abbau der Bargeldinfrastruktur besser rechtfertigen.
Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, Giovanni Pitruzzella, erkannte nur dort eine direkte Verbindung zwischen Bargeld und unseren Grundrechten, wo „Bargeld ein Element sozialer Eingliederung ist“. Im Verfahren Norbert Häring gegen den Hessischen Rundfunk argumentierte er, dass Banknoten und Münzen zwar auch mit anderen Grundrechten in Verbindung stünden, Bargeld jedoch „im Allgemeinen nicht erforderlich“ sei, „um diese Grundrechte auszuüben“. Was die Privatsphäre anbelangt, da sah Pitruzzella durch Bargeld lediglich „ein höheres Schutzniveau“ gewährleistet als durch andere Zahlungsmittel, ohne der Frage nachzugehen, ob bei digital protokollierten Zahlungen überhaupt noch von Privatsphäre zu sprechen ist.
Verdrängung des Bargelds
Ein zweiter Nachteil besteht darin, dass der digitale Euro die Preise für Kartenzahlungen senken könnte. Kleine Einzelhändler kosten Kartenzahlungen in Summe teilweise ein bis zwei Prozent des Umsatzes. In der Verordnung für den digitalen Euro ist jedoch mit Artikel 17 eine Gebührenschranke vorgesehen. In der Folge dürfte die Akzeptanz elektronischer Zahlungen im Handel zunehmen, während einige andere Firmen dann bereits darüber nachdenken, Bargeld ganz abzulehnen. Denn die Akzeptanz von Banknoten und Münzen ist für die Geschäfte ebenfalls eine Kostenfrage – vom Besorgen des Wechselgelds bis hin zum Fortschaffen der Einnahmen.
Wenn Bargeld teurer wird, weil die Bankfilialen verschwinden oder Münzgeldautomaten fehlen, und Kartenzahlungen im Preis sinken, entsteht ein Anreiz, Bargeld im eigenen Laden abzuschaffen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbands, Stefan Genth, beklagte im vergangenen Jahr steigende Kosten und warnte vor einem Zusammenbruch des Bargeldsystems.
Doch es gibt noch einen anderen Punkt: Der digitale Euro käme in Begleitung einer Informationskampagne, damit seine Einführung nicht in einem Misserfolg endet. Nun darf man sich fragen, wem der digitale Euro Marktanteile nimmt. Sollte er auch viele Barzahler überzeugen, beschleunigt sich die Negativspirale. Wer kein Bargeld nutzt, der hebt kein Bargeld ab. Somit verschwinden weitere Bankstandorte für den Bezug von Bargeld. Bei Händlern sinkt das Interesse an Banknoten und Münzen, je weniger Kunden damit bezahlen. Wer dann Bargeld an der Ladenkasse abschafft, hat womöglich ein besseres Gewissen, da der E-Euro auch von Menschen ohne Bankkonto genutzt werden kann.
Brüssel ist sich der Folgen bewusst
Experten der EU-Kommission schreiben in einem behördeneigenen Fachmedium, dass der digitale Euro Netzwerkeffekte bewirken und so zum Rückgang von Bargeld führen könne. Auf Nachfrage von Multipolar erläutert die Pressestelle in Brüssel, dass der E-Euro theoretisch zu einer sinkenden Nutzung von Bargeld und dadurch zu einer verminderten Akzeptanz von Bargeld im Handel führt beziehungsweise umgekehrt eine fallende Akzeptanz zu einer rückläufigen Nutzung von Banknoten und Münzen beiträgt. Jedoch habe man im Digital-Euro-Paket Schutzmaßnahmen vorgesehen, um „die Verwendung von Bargeld als weit verbreitetes Zahlungsmittel zu erhalten“.
Die Maßnahmen zum Schutz von Bargeld
Bei dem genannten Digital-Euro-Paket handelt sich um ein Gesetzespaket, bestehend aus der Verordnung über den digitalen Euro sowie einem Gesetzesentwurf über die Rolle von Banknoten und Münzen. Das Paket wurde 2023 vorgestellt. In der an den digitalen Euro gekoppelten Bargeld-Verordnung wird geregelt, was der Begriff „gesetzliches Zahlungsmittel“ in der Interpretation von EU-Kommission und Europäischem Gerichtshof zu bedeuten hat. Demnach gilt der Grundsatz der allgemeinen Annahmepflicht von Bargeld und das Verbot, Barzahlern eine Gebühr aufzuschlagen. Jedoch existiert eine solche Interpretation bereits und trotzdem lehnen Geschäfte Bargeld ab.
In Deutschland und der Schweiz herrscht die Meinung, dass ein gut sichtbares Schild an der Ladentür die ausschließliche Akzeptanz von Kartenzahlungen zu einem Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen macht. Wer den Laden betritt, der erklärt sich mit der Regel einverstanden. Diese sogenannte Vertragsfreiheit gilt so lange, bis der Gesetzgeber eine Strafe vorsieht. Auch in den Niederlanden, in Irland, Österreich, Finnland, Kroatien, Estland und Litauen vertreten auf Multipolar-Anfrage entweder die Nationalbank oder das zuständige Ministerium die Auffassung, dass Banknoten und Münzen mit dem Schild an der Tür abgelehnt werden können.
Von der Annahmepflicht ist in der Bargeld-Verordnung eine Ausnahme vorgesehen: Einigt sich der Käufer mit dem Verkäufer auf ein anderes Zahlungsmittel, so verliert der Käufer die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen. Im Gesetzesentwurf über den digitalen Euro existiert der gleiche Passus – dort jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt eines Artikels 10, wonach der Kunde das Recht behält, digitale Euros zu nutzen, wenn er von Anfang an damit einkaufen wollte. Das Schild an der Tür funktioniert also beim E-Euro nicht. Vor diesem Hintergrund schrieb Ex-Bundesbank-Vizepräsident Franz-Christoph Zeitler jüngst, Bargeld drohe zu einem Zahlungsmittel „zweiter Klasse“ zu werden. Die EU-Kommission sieht aber vor, dass die Regierungen überwachen müssen, wie verbreitet Barzahler an der Ladentür abgewiesen werden. Ufere die Ablehnung aus, seien Gegenmaßnahmen zu ergreifen und Strafen einzuführen.
Hintertüren erlauben die Verdrängung des Bargelds
Es ist jedoch nicht definiert, woran sich ausreichende Akzeptanz zeigt. Die EU-Kommission will erst nach Inkrafttreten der Verordnung festlegen, an welchen Indikatoren sich die Länder bei der Überwachung zu orientieren haben. Wenn also im Studiendesign der Akzeptanz-Überwachung zum Beispiel aus dem Raster fällt, dass es Bargeld-ablehnende Nahverkehrsmittel oder Hotels gibt, dann wird eine Problemlage in diesem Bereich nicht in die Bewertung einfließen und die Eurostaaten sehen sich am Ende nicht verpflichtet, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zu den geplanten Indikatoren will die EU-Kommission keine Auskunft geben.
Die Verordnung verlangt auch hinreichenden Zugang zu Bargeld. Doch unter welchen Umständen dieser Zugang gegeben ist, bleibt unklar. Wenn am Ende nur die reine Anzahl von Geldautomaten betrachtet wird, bleibt außen vor, dass an Fremdautomaten so hohe Gebühren anfallen, dass ein Zugang zu Bargeld de facto nicht gegeben ist. Wenn nur die Wegstrecke des Bürgers zu Bargeld-auszahlenden Einzelhändlern im Mittelpunkt steht, geht unter, dass an der Kasse mitunter zu wenig Bargeld vorhanden ist.
Als Knackpunkt erweist sich, dass bei Gegenmaßnahmen das „Gebot der Verhältnismäßigkeit“ zu beachten ist. Der EU-Spitzendiplomat Martin Selmayr erläuterte dem österreichischen „Standard“ die Hintergründe: „Verhältnismäßig“ hieße zum Beispiel, dass ein Kiosk weiterhin Bargeld ablehnen darf, während der große Supermarkt mit einer Strafe rechnen muss. Wer sagt, wie lange es verhältnismäßig erscheint, einen wenig genutzten Bankautomaten zu unterhalten?
Schon in der Verordnung erläutert die Kommission, dass zu den denkbaren Gegenmaßnahmen zählt, lediglich Beschränkungen „in bestimmten Sektoren, die als wesentlich erachtet werden, etwa Postämter, Supermärkte, Apotheken oder Gesundheitseinrichtungen“ einzuführen. Nach Auskunft der Pressestelle in Brüssel handelt es sich hierbei um eine „eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen für solche Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen könnten, um die weit verbreitete und strukturelle Verweigerung von Bargeld wirksam zu bekämpfen“.
Eine weitere Lücke im Gesetzesentwurf sind Möglichkeiten für die Unternehmen, Wechselgeld zu beschaffen und die Einnahmen fortzuschaffen. Das kann problematisch werden, weil in Deutschland keine Vorschrift besteht, dass Banken Wechselgeld beschaffen oder Einzahlungen annehmen müssen. Lediglich die Sparkassen besitzen explizit den Versorgungsauftrag mit „geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen“. Doch in welcher Form eine Versorgung etwa mit Münzgeld stattzufinden hat, ist nicht geregelt. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband schreibt auf Multipolar-Anfrage: „Es gibt keine spezifische gesetzliche Regelung, die Sparkassen direkt dazu verpflichtet, ein Netzwerk zur Bargeldversorgung ihrer Kundinnen und Kunden bereitzustellen.“
Weiterhin kein Recht auf Bargeldauszahlung
Selbst wenn ein gutes Netz mit Geldautomaten existierte beziehungsweise ein hinreichender Zugang zu Bargeld gegeben wäre, kann die Situation eintreten, dass ein Bankkunde an keinem Automaten (und bei keinem Einzelhändler) Banknoten bekommt. Relevant ist das, da immer mehr Online-Banken ohne eigene Filialen und Automaten auftreten. Auch bei solchen Girokontomodellen ist heute Bargeldauszahlung möglich. Doch wie wird das zukünftig sein? Ein Universitätsprofessor im Bereich Bankrecht und Bürgerliches Recht, der anonym bleiben will, kommt auf Multipolar-Anfrage zu dem Schluss: Die vertragliche Vereinbarung mit der Bank über das Girokonto kann vorsehen, dass kein Zugang zu Bargeld gegeben ist. Und was die Rückzahlung des Guthabens im Falle der Kontoauflösung betrifft, so reicht bereits eine Bemerkung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Bürger muss akzeptieren, dass die Bank ihre Schuld ihm gegenüber nur durch Überweisung in Euro auf sein neues Konto bei einem anderen Geldinstitut auflöst.
Die Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht Daniela Bergdolt bestätigt gegenüber Multipolar, dass Banken die Bargeldauszahlung vertraglich ausschließen können. Bislang habe kein höheres Gericht entschieden, das so etwas unrechtmäßig sei. „Es muss in den Vertragsbedingungen immer das drinstehen, was dann letztlich auch gemacht wird“, so Bergdolt. „Wenn man zustimmt, dann sind das die Vertragsbedingungen geworden.“ Die Anwältin bemerkt: „Die Verbraucher haben das Gefühl, dass eine Bank eine Art öffentlich-rechtlichen Auftrag wahrnimmt: ‚Die dürfen uns nicht kündigen, die müssen uns ein Konto gewähren.‘ Das ist nicht so. Die Bank ist genauso ein Marktteilnehmer wie jeder andere.“
Wird die Politik das Bargeld schützen?
Das weitere Schicksal des Bargelds hängt sehr vom Verhalten der EU-Institutionen und nationalen Regierungen ab. Was ist zu erwarten? Die EU-Kommission hat jahrelang ignoriert, wie die Bargeldinfrastruktur in Ländern wie den Niederlanden, Belgien oder Finnland geschwächt wurde. Sie folgte dem Motto des früheren EU-Digitalkommissars Günther Oettinger: „Der Markt macht es.“ Oettinger sagte 2016 auch: „Bargeld stirbt aus: Wir werden mit der Apple-Watch bezahlen, mit dem Smartphone bezahlen.“
Dabei besitzt die EU nach Artikel 133 AEU-Vertrag auf EU-Verfassungsebene den Auftrag, die Maßnahmen zu ergreifen, die zum Erhalt der gemeinsamen Währung erforderlich sind. Erst jetzt, gestützt auf diesen Artikel, möchte die EU-Kommission den digitalen Euro einführen und damit die Nutzbarkeit des Euro in allen Bereichen sicherstellen. Dieses Ziel hätte sie bislang jedoch durch den konsequenten Schutz des Bargelds verwirklichen müssen.
Die Bargeld-Verordnung kam erst auf den Tisch, als Brüssel einen E-Euro einführen wollte, und ist Teil des Digital-Euro-Pakets. Damit unterstreicht Brüssel, dass der digitale Euro das Bargeld nur ergänzen, aber nicht ersetzen solle. In der Vergangenheit hat die EU-Kommission aber viel dafür getan, Kartenzahlungen im Wettbewerb gegen Bargeld zu begünstigen: So hat sie mit Echtheitsprüfungsvorschriften dafür gesorgt, dass die Bankgebühren für die Einzahlung der Münzgeldeinnahmen stark angestiegen sind. Alle Münzen müssen geprüft werden. Und das obwohl die kleineren Stückelungen mit einem Wert unter 50 Cent gar nicht gefälscht werden, wie die Bundesbank auf Multipolar-Anfrage einräumt. Gleichzeitig hat Brüssel in einer entscheidenden Phase erreicht, dass die Kartenzahlungsgebühren für Händler – vorübergehend – sinken. Erklärtes Ziel war es, Bargeld zurückzudrängen und die Akzeptanz von Kartenzahlungen zu fördern.
Die passive Haltung der EZB
Die EZB legte 2023 ein Wort für Banknoten und Münzen ein, als sie einen unmittelbaren Bargeld-Annahmezwang bei Strafe forderte, anstelle einer Überwachung, wie verbreitet Barzahler abgewiesen werden. Den Punkt der Bargeld-Verfügbarkeit, wo es auf die Banken ankäme, klammerte sie jedoch komplett aus. Wie die EU-Kommission verhielt sich die EZB jahrelang äußerst passiv, während die Bargeldinfrastruktur von den Banken in verschiedenen Euroländern abgebaut wurde. Sie protestierte nicht öffentlich, dass Unternehmen in den Niederlanden immer verbreiteter Bargeld ablehnen. Die EZB lieferte sich auch keinen Schlagabtausch mit der Kommission, als die Marktbedingungen zu Gunsten der digitalen Zahlungsmittel der Banken und Kartenunternehmen verändert werden sollten.
Anders als die Deutsche Bundesbank trat sie zu Beginn der Coronakrise nicht vor die Kamera, um die Gerüchte zu zerstreuen, wonach man sich mit Bargeld anstecke. Stattdessen verkündete EZB-Vorstand Fabio Panetta Ende 2020 in zahlreichen Medien die Notenwendigkeit einer intensiven Arbeit am digitalen Euro und begründete das mit dem Trend an der Ladenkasse weg vom Bargeld. Ein irgendwie geartetes Engagement der Zentralbank, kreative Lösungen zu finden, wie das Bargeld trotz zurückgehender Nutzung ein preiswertes Zahlungsmittel für den Einzelhandel bleiben kann, ist nicht wahrzunehmen.
Die Kartenunternehmen greifen auf ein enormes Budget zurück, um für ihre Dienstleistungen zu werben. Die EZB dagegen führt keine Kampagnen, um den gesellschaftlichen Wert von Bargeld ins Gespräch zu bringen oder um Fehlinformationen über Bargeld in der breiten Öffentlichkeit richtigzustellen.
Das Verhalten der Zentralbank steht in einem gewissen Widerspruch zu dem, was ein EZB-Direktor im vergangenen Jahr in einem Webinar sagte: „Sie können uns glauben, dass wir Bargeld mögen. Bargeld ist unser Baby und wir sind die Einzigen, die Banknoten ausgeben können, und wir wollen, dass die Menschen weiterhin Banknoten verwenden.“ Noch 2015 sagte ein EZB-Vorstand, Benoît Cœuré, vor Investoren in London: „Obwohl ich mir eine Welt ohne Bargeld gut vorstellen kann, sehe ich dies als das Ergebnis technologischer Veränderungen und eines Wandels in der Gesellschaft – nicht als Folge politischer Maßnahmen.“ Zu dieser Zeit gab es viele Stimmen, die über einen Ausstieg aus dem Bargeld laut nachdachten. Um sie wurde es jedoch stiller, sicher auch weil sich die Debatte emotionalisierte und in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Definitiv ist die mittlere Ebene der EZB heute bargeldfreundlich eingestellt. Dieser Einfluss auf die Währungspolitik könnte jedoch abnehmen, wenn der digitale Euro an Bedeutung gewinnt.
Als Christine Lagarde 2019 zur neuen EZB-Präsidentin nominiert war, musste sie sich zunächst den Fragen der EU-Abgeordneten im Währungsausschuss stellen. Markus Ferber legte den Finger in die Wunde und sprach mehrere Fachartikel an, die der Internationale Währungsfonds (IWF) zuvor unter Lagardes Präsidentschaft publiziert hatte. Die Publikationen widmeten sich zum Beispiel der Frage, wie Negativzinsen nicht nur auf Bankguthaben, sondern auch auf Bargeld erhoben werden könnten. Eine Arbeit des ranghohen und mit Lagarde bekannten IWF-Ökonoms Aleksej Kirejew analysierte, wie Regierungen das Bargeld schrittweise beseitigen könnten, ohne den Widerstand der Bevölkerung zu wecken.
Für Lagarde besaß es keine Priorität, Ferber gegenüber eine Abschaffung des Bargelds auszuschließen. Sie sagte, dass man abwägen müsse, welche geldpolitischen Werkzeugen geeignet sind, in der Zukunft im Krisenfall das System zu stützen, und dass es eine Kosten-Nutzen-Analyse brauche. Der Tagesschau-Korrespondent Klaus-Rainer Jackisch kommentierte daraufhin: „Bargeld abschaffen? Auch das ist denkbar, wenn’s hilft.“
Am 20. Januar 2016 stimmte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos der Prognose des Deutsche-Bank-Chefs John Cryan zu, dass Bargeld in zehn Jahren nicht mehr existieren werde. Cryan forderte in dieser Runde, Bargeld „sollte entmaterialisiert werden“. An demselben 20. Januar 2016 hatte die Zentralbank von China einen digitalen Yuan angekündigt. Deren Chef Zhou Xiaochuan sagte damals im Interview: „Die digitale Währung wird noch eine ganze Weile neben dem Bargeld existieren, bevor sie es endgültig ersetzt.“
Der rechtliche Schutz des Bargelds
Artikel 128 AEU-Vertrag und Artikel 16 der EZB-Satzung verhindern derzeit eine komplette Bargeldabschaffung. Eine Änderung bedarf in beiden Fällen der Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Banknoten werden daher grundsätzlich ein Zahlungsmittel bleiben, das von jedem angenommen werden muss, wobei nicht klar ist, in welchem Umfang die Wirtschaft dazu übergehen kann, Bargeld mit einem Schild an der Ladentür abzulehnen, ohne den Grundsatz der Annahmepflicht zu untergraben.
Nach Artikel 128 Absatz 1 AEU-Vertrag besitzt die EZB das „Recht“, den nationalen Notenbanken die Ausgabe von Euro-Banknoten zu erlauben. Laut Bundesbank ist allerdings nicht geklärt, ob sich aus diesem Wortlaut auch eine Verpflichtung ergibt, Bargeld in Umlauf zu bringen. Während ein deutscher Rechtswissenschaftler vor Jahren eine Pflicht für die EZB durch Artikel 128 bestritt, argumentierte ein Professor aus Brüssel auf einem Kongress der Zentralbank in 2024, dass aus dem Status von Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel ein Auftrag an die EU-Institutionen hervorgehe, das Recht der Bürger zu schützen, eine Zahlungsverpflichtung immer mit Euro-Banknoten erfüllen zu können.
Wie die Diskussion auch ausgehen mag, es existieren noch andere Hürden: Der Deutsche Sparkassen- und Giro-Verband schreibt auf Anfrage von Multipolar, in der Praxis ergebe sich „ein essenzieller Anspruch darauf, Zentralbankguthaben in gesetzliches Zahlungsmittel (Bargeld) umzuwandeln“. Die deutschen Banken sind verpflichtet, eine bestimmte Menge Geld auf dem Konto der Bundesbank zu halten. Den Überschuss müssen sie sich ausbezahlen lassen können – in dem Zahlungsmittel der Notenbank, dem Bargeld. Würde die Bundesbank das Geld nicht mehr herausrücken, kämen sich die Banken enteignet vor.
Wenn die Politik das Bargeld abschaffen wollte, wäre daher die Mindestvoraussetzung, den digitalen Euro zu etablieren und gleichzeitig den Banken zu erlauben, unbegrenzt Geld in digitalen Euros zu halten. Dann könnten Banken ihren Überschuss in E-Euros statt Bargeld ausbezahlt bekommen und hätten kaum noch die Möglichkeit, Banknoten zu beschaffen, um ihren Kunden Bargeldauszahlung anzubieten. Allerdings schreibt die Bundesbank auf Multipolar-Anfrage, dass die E-Euro-Verordnung Banken nicht in die Lage versetze, selbst in das Eigentum von E-Euros zu kommen. Und inwieweit ein solches Szenario überhaupt realistisch ist, bleibt offen.
Was die hohe Politik über die Welt von morgen denkt
Die EZB-Spitze bereitet sich jedenfalls längerfristig auf den Verlust von Bargeld als Zahlungsmittel vor. Das zeigte sich bei einem Auftritt des EZB-Vorstands Pierro Cipollone, dem Nachfolger von Fabio Panetta, vor dem Währungsausschuss des EU-Parlaments im Februar 2024. Gegenüber einem niederländischen Parlamentarier verteidigte er dort das Projekt des digitalen Euros:
„Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass die Menschen weiterhin Bargeld nutzen können (…) Aber wir können nicht kontrollieren, was der Markt tun wird. Ein Beispiel: Haben Sie gesehen, wie viele Supermärkte die Art und Weise verändern, wie man bezahlt? Es gibt nur noch sehr wenige Stellen (also Kassen), an denen man mit Bargeld bezahlen, und viele Stellen, an denen man mit beliebigen anderen Zahlungsmitteln bezahlen kann. Also, die Technologie, um mit Bargeld zu bezahlen, wird verschwinden.“
Cipollone schloss mit den Worten: „Wir haben die Verantwortung, vorbereitet zu sein, denn eines Tages könnten die Leute sonst zu uns kommen und sagen: ‚Wir haben in unserer Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, staatliches Geld zu nutzen – was haben Sie getan, um das zu verhindern?‘ In dieser Situation möchte ich nicht sein.“ Cipollone scheint also nicht zu glauben, das Bargeld dauerhaft erhalten zu können, auch nicht mit dem geplanten Gesetzesentwurf. Und durch das inkludierte „Gebot der Verhältnismäßigkeit“ dürfte sich die Wirksamkeit der Verordnung abschwächen, je weniger Leute Bargeld nutzen.
Auf internationaler Bühne äußert man sich zum Teil offener. Basel ist Sitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, quasi die Zentralbank der Zentralbanken und Treffpunkt für die einflussreichsten Notenbanker der Welt. Deren Chef Agustín Carstens sagte 2019 in Dublin, ganz ohne Zweifel darüber, wie eine Welt aussähe, in der sich die Digitalwährungen etabliert haben: „Auf den ersten Blick ändert sich nicht viel für jemanden, der beispielsweise auf dem Heimweg von der Arbeit im Supermarkt vorbeikommt. Er oder sie hätte nicht mehr die Möglichkeit, bar zu bezahlen. Alle Einkäufe werden elektronisch getätigt. Aber ab hier werden die Unterschiede deutlich: Eine digitale Zentralbankwährung ist nicht unbedingt anonym wie Bargeld (…)“
Auch Finanzminister Christian Lindner schien das für möglich zu halten, als er den E-Euro als Bargeld-Ersatz ins Gespräch brachte: Er nahm an der Podiumsdiskussion im November 2022 teil, auf der Fabio Panetta 50 Euro als Grenze für E-Euro-Zahlungen ohne staatliche Aufsicht vorschlug. Lindner sagte zu Panetta, dass das schon sehr wenig sei und die Leute das nicht akzeptieren würden. Im Anschluss an die Konferenz twitterte Christian Lindner, dass „digitales Cash“ – gemeint ist der E-Euro – „nur dann in der Breite als Ergänzung oder gleichwertiger Ersatz für Scheine und Münzen akzeptiert“ würde, wenn die Privatsphäre geschützt sei.
Die Zentralbank von Kanada sieht eine Digitalwährung als das Zahlungsmittel, das Banknoten und Münzen ersetzt, wenn Bargeld an den Point of no Return kommt, also an den Punkt, an dem es der Politik nicht mehr verhältnismäßig oder realisierbar erscheint, dafür zu sorgen, dass seine Infrastruktur aufrechterhalten bleibt. Im Sommer 2024 schrieb die Notenbank in einer Publikation: „Bargeld wird in Zukunft wahrscheinlich an Bedeutung verlieren und sollte es jemals so weit zurückgehen, dass es als Zahlungsmittel nicht mehr tragfähig ist, dann würde eine richtig konzipierte staatliche Digitalwährung dazu beitragen, die Lücke zu schließen und die Bedeutung staatlichen Geldes in der Wirtschaft aufrechtzuerhalten.“
Es liegt in der Hand des Bürgers
Zu den Eigenschaften von Banknoten und Münzen zählt die Freiheit, das versteuerte Einkommen in den eigenen Händen zu halten, die Unabhängigkeit des Bürgers vor dem direkten Zugriff des Staates auf das Geld, Anonymität beim Bezahlen, Handlungsfähigkeit bei technischen Ausfällen, bessere Kontrolle über die eigenen Ausgaben, Förderung eines disziplinierten Umgangs mit Geld auch bei Kindern, Inklusion von Menschen mit Sehbehinderung, Downsyndrom und anderen Einschränkungen, die Möglichkeit, selbstständig Geld zu verdienen, ohne vorher ein Bankkonto zu eröffnen, und Autonomie gegenüber den Gebühren-Vorstellungen der Finanzwirtschaft.
Wenn die ausschließlichen Merkmale von Bargeld und die Folgen seiner Verdrängung in die öffentliche Wahrnehmung rücken, kann der Bürger an der Ladenkasse eine bewusste Entscheidung treffen, ob er digital bezahlt und damit auf das Verschwinden von Bargeld hinwirkt oder ob er Scheine und Münzen nutzt und somit dazu beiträgt, dass sich auch künftige Generationen die Eigenschaften von Bargeld zunutze machen können.
Die Politik wird sich dieselbe Frage stellen müssen und im Ergebnis entweder auf einen konsequenten Schutz des Bargelds verzichten oder aber den Zugang zu Bargeld und seine Akzeptanz sicherstellen.