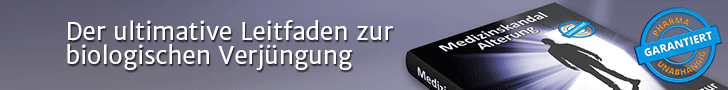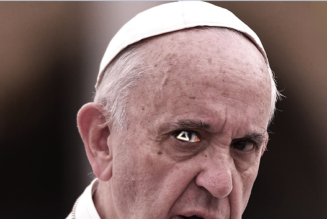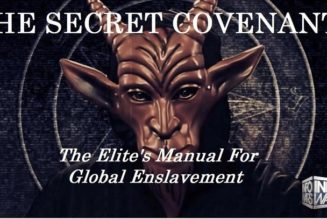Ihr weltweiter Energieverbrauch übersteigt bereits den von ganz Frankreich und soll sich bis 2030 vervierfachen. Aber es gibt Möglichkeiten, die Auswirkungen von Rechenzentren auf das Klima zu begrenzen.
Eingebettet in die Seite eines norwegischen Berges, hat DC1 alles von einem vorbildlichen Rechenzentrum, zumindest auf der grünen Ebene. Seine blinkenden Maschinen reihen sich in langen Betonkorridoren aneinander und geben einem alten Munitionslagertunnel der NATO ein zweites Leben. Besser, um diese überhitzten Computer zu kühlen, wird Wasser mit 8 Grad direkt aus dem nahen Fjord geschöpft. Deutlich energieeffizienter als herkömmliche Klimaanlagen. Am Ende des Tages wird das so auf 20 Grad erwärmte Meerwasser im nächsten Jahr evakuiert zu … einer Hummerfarm; 20 Grad ist offenbar die optimale Temperatur für das Wachstum dieser edlen Krebstiere. Diese zukünftigen Köstlichkeiten, die in norwegischen Restaurants serviert werden, werden also auf Hochtouren geschwommen sein, gebadet in der Restwärme der Speicherung unserer Daten.
Dies ist die Quintessenz der Geschichte, die Bauherren von Rechenzentren gerne erzählen. Aber nicht alle sind gleich tugendhaft: Diese Anlagen saugen bereits zwischen 1 und 3 % des weltweit produzierten Stroms auf. Anfang 2020 wurde ihr Verbrauch auf 650 Terawattstunden geschätzt, mehr als der Verbrauch Frankreichs. Und angesichts des exponentiellen Wachstums des Datenspeicherbedarfs könnte sich diese Zahl Schätzungen zufolge bis 2030 verdreifachen, vervierfachen oder verfünffachen.
Data Farms kündigen sich damit „unter den wichtigsten Stromverbrauchern des 21. Jahrhunderts“ an, heißt es in einem Bericht von Ademe, der Public Agency for Ecological Transition. Diese Datenhotels sind wegen des Stromverbrauchs für die Stromversorgung der Server (oder Computer) und des Wassers, das zu ihrer Kühlung verwendet wird, besonders umweltschädlich – ein durchschnittlich großes Zentrum verschlingt 600.000 Kubikmeter pro Jahr, was 6,5 olympischen Schwimmbecken pro Tag entspricht.
Denn weit davon entfernt, eine entmaterialisierte und abstrakte Wellenwolke zu sein, die über unseren Köpfen schwebt, basiert die Wolke auf konkreten Infrastrukturen, die ständig unter Spannung stehen. „Die Leute wissen es nicht, aber diese Installationen verbrauchen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche viel Energie: Sie können nicht aufhören zu arbeiten und müssen sogar einem Stromausfall oder einem Bagger standhalten, der die Glasfaser schneidet …“, listet Arnaud de Bermingham auf, Chef von Scaleway, dem Tochterunternehmen von Iliad (Free), das sich der Cloud verschrieben hat. Daher die erheblichen Redundanzen: Die meisten unserer Daten werden an mehreren Speicherorten repliziert, was die Serveranforderungen und den Verbrauch entsprechend erhöht.
Der Strom, mit dem diese Energiesenken versorgt werden, ist jedoch nicht immer der sauberste. In den USA kommt es sogar massiv aus Kohle. „Es ist paradox zu erkennen, dass diese Symbole unserer modernen Wirtschaft auf Infrastrukturen beruhen, die aus der ersten industriellen Revolution stammen“, bemerkt der Journalist Guillaume Pitron, der gerade ein erbauliches Buch der verborgenen Verschmutzung der digitalen Welt gewidmet hat, „L „enfer digital: Reise nach einem Like“ (Hrsg. Les Liens qui liberante). Er fand heraus, dass die Kohleminen, die Appalachia verunstalten, durch die explosive Methode der „Berggipfelentfernung“ die Rechenzentren speisen, die es in Ashburn County, Virginia, gibt.
Amazon Web Services (AWS), der Weltmarktführer in der Cloud, hat dort viele Server, 37 % davon mit Kohle betrieben, der Durchschnitt in diesem Staat, einer der letzten Bastionen dieses Brennstoffs. Dies hindert Netflix, einen der größten Kunden von AWS, nicht daran, ein Ziel von null Treibhausgasemissionen bis Ende 2022 anzukündigen, insbesondere durch die Finanzierung von Projekten für erneuerbare Energien. „Cloud-Akteure haben keine andere Wahl, als über das Thema zu kommunizieren und ihren Strommix grüner zu machen“, betont Guillaume Pitron.
Für die Cloud-Giganten gibt es jedoch einen anderen Weg: das Energiegewicht ihrer Serverfabriken an der Quelle zu reduzieren. Wenn 50 % des Stroms, den sie verbrauchen, für den Betrieb der Computer verwendet werden, fließen durchschnittlich 40 % in die Klimaanlage, mit der sie gekühlt werden. „So viel verschwendete Energie“, sagt Arnaud de Bermingham von Scaleway. Kalte Außenluft kann mit der Methode der „freien Kühlung“ tatsächlich als natürliche Klimaanlage genutzt werden. Auch große Namen der Branche haben sich aus diesem Grund im hohen Norden niedergelassen: Facebook hat sein europäisches Hauptrechenzentrum in Lappland errichtet, andere entscheiden sich für Grönland oder Island… Aber Scaleway beweist, dass diese Technik auch in Frankreich eingesetzt werden kann.
In Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) nutzt das DC5-Center massiv die Außenluft. „Die Server geben eine Hitze von 60 Grad ab und sie brauchen eine Umgebung unter 30 Grad, um richtig zu funktionieren“, erklärt der CEO. Aber auch in unseren Breitengraden reicht zu 80 % die Außenluft aus, um die Temperatur zu senken. Wenn es im Winter zu kalt ist, wird es mit der warmen Luft aus dem Rechenzentrum wieder gemischt, um die richtige Temperatur zu erreichen. Und wenn es im Sommer zu heiß wird, nutzt Scaleway ein ausgeklügeltes Wasserverdunstungssystem, um die Luft zu kühlen. „Es ist ein uralter Prozess, der nur wenige Gramm Wasser pro Kilo Luft benötigt“, schließt Arnaud de Bermingham. So viel wie der Verbrauch von zwei durchschnittlichen Haushalten, kaum…
Andere Hersteller konzentrieren sich lieber auf den Downstream und nutzen die Abwärme von Rechenzentren. „Da sie auf jeden Fall produziert wird, ist es vernünftig, diese lokale und billige Energie zurückzugewinnen“, erklärt Yannick Duport, kaufmännischer Leiter von Dalkia, einer Tochtergesellschaft von EDF. In Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) arbeitete es an einem 10.000 Quadratmeter großen Rechenzentrum, in dem Bankdaten untergebracht sind: Seine Wärme versorgt jetzt ein Wassersportzentrum, ein Gründerzentrum und eine Gemeinschaftsküche.
Ein weiteres Erlebnis in Montluçon (Allier), wo Dalkia in Zusammenarbeit mit dem Start-up Tresorio einen „digitalen Boiler“ entworfen hat: Dort wird eine Serverbucht verwendet, um die 48 Wohnungen eines Gebäudes zu bewässern. „Genug, um fünf Minuten lang 140 Duschen bei 37 Grad zu brausen“, freut sich Yannick Duport. Die Übung hat jedoch laut einem Industriellen der Branche ihre Grenzen: „Das in Rechenzentren gesammelte Wasser hat maximal 40 Grad, wenn der Standard-Sanitärgebrauch 60 Grad erfordert: Es wäre notwendig, dies mit einer Wärmepumpe zu ergänzen nicht ist keine zufriedenstellende Lösung.
Ein weiterer Fallstrick: Das produzierte Warmwasser kann aufgrund seiner Temperatur nur sehr lokal genutzt werden – es kann über weniger als 1 Kilometer transportiert werden. Die größten Rechenzentren sind jedoch oft in den Vororten isoliert. „Dieses System ist noch nicht industrialisiert, es sollte mit erneuerbaren Energien gemischt werden“, räumt Yannick Duport ein.
Das Wachstum der Cloud beinhaltet vorerst den Bau riesiger, traditionell klimatisierter Rechenzentren, der „Hyperscales“. Sie konzentrieren sich auf Ballungsräume, die auf diesen Empfang spezialisiert sind, wie Dublin, London, Frankfurt oder Amsterdam. Und vor Ort werden diese Einrichtungen nicht ohne Spannungen durchgeführt. Im Jahr 2019 beschloss Amsterdam, den Kibosh darauf zu setzen, da 10 % des Stroms der Stadt bereits von den Servern erfasst wurden. In Dublin verbrauchen Computer bereits mehr als die Einwohner.
Und in Frankreich? Allein die Ile-de-France beherbergt 90 % der Rechenzentren des Landes (d. h. 123 gezählte Standorte im Jahr 2019) mit privilegierten Gebieten wie Seine-Saint-Denis. Dies ist nur der Anfang: „Wir haben erkannt, dass die Rechenzentren ein Drittel des Stroms des Großraums Paris erfassen werden“, erklärte 2019 ein Vertreter von GRDF. Der Gigantismus scheint mehr denn je in Ordnung. In Lisses, in Essonne, plant ein Standort des Unternehmens cloudHQ, sich über 100.000 Quadratmeter zu erstrecken, für einen erwarteten Rekordverbrauch… Weit entfernt von CO2-Neutralität hat der Energieverbrauch der Cloud nicht aufgehört zu wachsen.