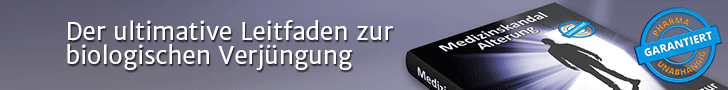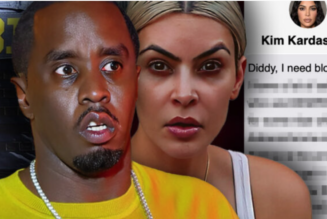Was eine aktuelle Studie für die globale Klimapolitik bedeutet
Im Jahr 2022 veröffentlichte ein Team von 23 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt — Experten für Sonnenphysik, Klimatologie und Atmosphärenwissenschaften — einen von Experten begutachteten Artikel in Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), der eine der am stärksten verankerten Annahmen der modernen Klimapolitik in Frage stellen könnte.
von Mark Keenan
Die vom Zentrum für Umweltforschung und Geowissenschaften (CERES) hervorgehobene Studie ergab, dass der Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) bei der Bewertung des Einflusses der Sonne auf den Klimawandel nur einen kleinen Teil der verfügbaren Datensätze zur gesamten Sonneneinstrahlung (TSI) berücksichtigt hat – insbesondere solche, die eine geringe Sonnenvariabilität zeigen.
Die Folge davon ist laut den Autoren, dass der IPCC möglicherweise voreilig war, als er eine wesentliche Rolle der Sonne bei der jüngsten Erwärmung ausschloss.
Die Verbindung zwischen Sonne und Klima neu untersuchen
Die Forscher analysierten 16 wichtige Datensätze zur Sonnenaktivität, darunter auch diejenigen, die vom IPCC verwendet werden.
Ihre Ergebnisse waren frappierend: Je nachdem, welche Datensätze verwendet werden, können Wissenschaftler zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen darüber gelangen, was die modernen Temperaturtrends antreibt.
Dr. Ronan Connolly, Hauptautor der Studie, erklärt:
„Der IPCC hat den Auftrag, einen Konsens über die Ursachen des Klimawandels zu finden. Aber Wissenschaft funktioniert nicht nach Konsensprinzipien.
Indem der IPCC praktisch nur die Datensätze berücksichtigt, die seine gewählte Erzählung stützen, hat er den wissenschaftlichen Fortschritt beim Verständnis der Ursachen des Klimawandels behindert.“
Diese Schlussfolgerung trifft den Kern des „Problems der Zuordnung des Klimawandels“ – welcher Anteil des behaupteten geringen Anstiegs der Erwärmung ist natürlichen und welcher Anteil menschlichen Ursachen zuzuschreiben?
Durch die Einschränkung der akzeptierten Daten hat der IPCC möglicherweise „unbeabsichtigt“ die offensichtliche Rolle der Treibhausgase verstärkt und gleichzeitig die natürlichen Schwankungen minimiert.
Wenn Konsens zur Einschränkung wird
Nicola Scafetta, Professor für Ozeanographie und Atmosphärenphysik an der Universität Neapel, argumentiert, dass es sich hierbei nicht nur um eine technische, sondern auch um eine philosophische Frage handelt:
„Der mögliche Beitrag der Sonne zur Erwärmung im 20. Jahrhundert hängt von den spezifischen Sonnen- und Klimadaten ab, die herangezogen werden.
Der Ansatz des IPCC, der auf Daten basiert, die die geringste Sonnenvariabilität zeigen, minimiert die natürliche Komponente und maximiert die anthropogene.“
Mit anderen Worten: Wenn man davon ausgeht, dass die Sonne stabil ist, muss jede Veränderung vom Menschen verursacht sein.
Dieser Ansatz vereinfacht zwar die politische Kommunikation, birgt jedoch die Gefahr, die Realität zu verzerren.
Víctor Manuel Velasco Herrera von der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko merkte an, dass alle 23 Mitautoren ihre Forschungsschwerpunkte beiseite legten, um „eine faire und ausgewogene wissenschaftliche Überprüfung“ des Zusammenhangs zwischen Sonne und Klima zu erstellen – eine Perspektive, die laut UN-Berichten „größtenteils übersehen oder vernachlässigt“ worden war.
Empirische Beweise von den Sternen?
Mehrere Mitwirkende bringen jahrzehntelange Beobachtungsdaten ein.
Gregory Henry, leitender Wissenschaftler an der Tennessee State University, hat die Helligkeitsänderungen von mehr als 300 Sternen beobachtet.
Er behauptet:
„Sterne, die unserer Sonne ähnlich sind, zeigen Helligkeitsänderungen, die mit denen der Sonne vergleichbar sind …“
Richard C. Willson, leitender Forscher für die ACRIM-Satellitenserie der NASA, fügt hinzu, dass das „Konzept, das zur gescheiterten CO₂-basierten Hypothese der globalen Erwärmung führte“, auf veralteten Zirkulationsmodellen beruht, die nicht mit den Beobachtungsdaten übereinstimmen.
Er betont, dass das Klima der Erde in erster Linie durch Schwankungen der Sonnenstrahlung bestimmt wird.
Dr. Willie Soon von CERES, der seit über drei Jahrzehnten die Wechselwirkungen zwischen Sonne und Klima erforscht, weist darauf hin, dass Variabilität „die Norm und nicht die Ausnahme“ ist:
„Aus diesem Grund hätte die Rolle der Sonne beim jüngsten Klimawandel niemals so systematisch heruntergespielt werden dürfen, wie es in den Berichten des IPCC geschehen ist.“
Auswirkungen auf die globale Politik
Die Auswirkungen dieser Debatte reichen weit über das Labor hinaus.
Seit 1988 bilden die Berichte des IPCC die wissenschaftliche Grundlage für UN-Klimaverträge und nationale Energiepolitiken.
Billionen von Dollar an Kohlenstoffsteuern, Subventionen und regulatorischen Rahmenbedingungen basieren auf der Annahme, dass menschliche CO₂-Emissionen die Hauptursache für die moderne Erwärmung sind.
Wenn natürliche Sonnenvariabilität eine größere Rolle spielt als anerkannt, dann könnten diese enormen wirtschaftlichen Veränderungen auf einem fragilen Fundament beruhen.
Professor Ana G. Elias von der Nationalen Universität Tucumán betont:
„Alle relevanten langfristigen Klimatreiber – nicht nur die anthropogenen – müssen berücksichtigt werden.“
Wenn sich ihre Warnung als richtig erweist, könnten Klimapolitikmaßnahmen, die sich eng auf die Kohlenstoffkontrolle konzentrieren, nur geringe Vorteile für die Umwelt bringen, während sie gleichzeitig hohe soziale und wirtschaftliche Kosten verursachen.
Die Politik der Gewissheit
Das Konsensmodell des IPCC wurde entwickelt, um die Wissenschaft für politische Entscheidungsträger zu vereinfachen, doch Konsens kann auch zu einer Einschränkung werden.
Durch den Ausschluss von Daten, die das Narrativ verkomplizieren könnten, laufen Institutionen Gefahr, die Wissenschaft zu einem Instrument der Regierungsführung statt der Erkenntnisgewinnung zu machen.
Die neue RAA-Studie unterstreicht, dass Unsicherheit nicht gleichbedeutend mit Unwissenheit ist – sie ist vielmehr der Motor des wissenschaftlichen Fortschritts.
Wenn Unsicherheit politisch ungelegen kommt, wird sie tendenziell unterdrückt.
Professor Velasco Herrera bezeichnete die Studie als „besonders“, gerade weil sie Forscher aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen ideologischen Standpunkten zusammenbrachte, um Fragen wieder aufzuwerfen, die lange Zeit als geklärt galten.
In diesem Sinne stellt die Studie nicht nur eine wissenschaftliche Neubewertung dar, sondern auch eine philosophische – einen Aufruf zur Wiederherstellung der offenen Forschung in einem Bereich, der zunehmend von Konsenspolitik beherrscht wird.
Bedenkt man außerdem, dass mehr als 2.000 Wissenschaftler und Klimaexperten öffentlich erklärt haben, dass der Klimawandel nicht durch CO₂-Emissionen verursacht wird, wird das Bild noch „beunruhigender”.
Die Klimafrage neu aufrollen
Keiner der Autoren behauptet, eine endgültige Antwort zu haben.
Vielmehr laden sie zu einer breiteren Diskussion darüber ein, wie natürliche und anthropogene Faktoren zusammenwirken und das Klima beeinflussen.
Die Sonne als primäre Energiequelle der Erde muss dabei im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen.
Wenn die Ergebnisse zutreffen, deuten sie darauf hin, dass der moderne Klimawandel nicht allein anhand von Kohlenstoffkennzahlen verstanden oder gesteuert werden kann.
Zu den wahren Treibern könnten auch Sonnenvariabilität und natürliche Rückkopplungssysteme gehören, die keine globale Politik kontrollieren kann.
Für normale Bürger bedeutet dies, dass die umfassenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die derzeit im Namen des „Klimaschutzes” gerechtfertigt werden, auf unvollständigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen könnten.
Die Forderung, die sich aus dieser Studie ergibt, ist nicht Leugnung, sondern wissenschaftliche Bescheidenheit – die Bereitschaft zu hinterfragen, ob die Modelle, die die globale Politik leiten, wirklich die komplexe Realität der Beziehung zwischen Erde und Sonne widerspiegeln.