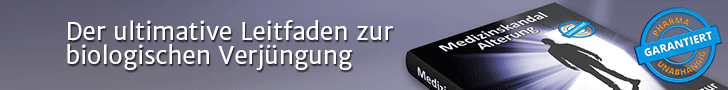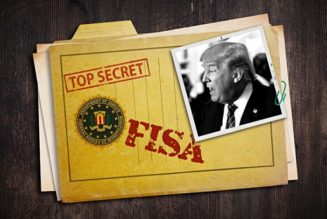Solche Daten sind in den Ergebnissen einer Umfrage enthalten, die vom HSE-Institut für statistische Forschung und Wissensökonomie unter mehr als tausend Fertigungs-, Bergbau- und Energieunternehmen aus 30 russischen Regionen durchgeführt wurde.
Knapp die Hälfte der Befragten (45,5 Prozent) plant eine Ausweitung der Nutzung, jeder Dritte (36,9 Prozent) bis Ende 2024.
Generell entspricht der Trend den globalen Trends – weltweit erwartet mehr als die Hälfte der Top-Manager großer Unternehmen, den Einsatz digitaler Technologien in den nächsten fünf Jahren auszubauen.
In den letzten Jahren entfaltet sich die vierte industrielle Revolution in vollem Gange, Industrie 4.0 entwickelt sich, was zur Einführung grundlegend neuer Lösungen in der Produktion führt. Einen zusätzlichen Schub für die neue Generation digitaler Technologien gab die COVID-19-Pandemie. Technologischer Kern der Fertigungsindustrie der Zukunft sind künstliche Intelligenz, Big Data, das Internet der Dinge und digitale Zwillinge, die die Produktion optimieren.Bis 2024 wird ein Drittel der russischen Fertigungsunternehmen „digitale Zwillinge“ einführen
Die größten Industrieunternehmen haben vor einigen Jahren begonnen, mit „digitalen Zwillingen“ zu experimentieren. Die gesammelten Erfahrungen ermöglichen es, auf ihrer Grundlage effektivere Systeme zum Management des Lebenszyklus von Produkten zu implementieren.
In Russland will laut einer Studie der Higher School of Economics ein Drittel der Industrieunternehmen bis 2024 „digitale Zwillinge“ einsetzen.
Ein noch größerer Anteil der Organisationen – mehr als 40 Prozent – erwartet, das Internet der Dinge bis zu diesem Zeitpunkt zu nutzen. Spitzenreiter bei den technologischen Erwartungen sind Big Data und künstliche Intelligenz, die etwa die Hälfte aller befragten Unternehmen der Branche einsetzen wollen.
Die Geschwindigkeit der Digitalisierung und ihre Zusammensetzung sind jedoch branchenübergreifend sehr unterschiedlich. Die Legierung aus „historisch“ bedingten und dringenden Herausforderungen, Problemen und Aufgaben bildet die Agenda für die Einführung neuer Technologien in der Industrie. Daher ist es heute für den Kraftstoff- und Energiekomplex wichtig, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.
Gefragt sind Lösungen, die eine Überwachung und Steuerung der Umweltsituation sowie eine schnelle Reaktion auf Notfälle ermöglichen.
Im Öl- und Gassektor zielt die Digitalisierung vor allem darauf ab, das Niveau der Ressourcenentnahme zu halten und die Kosten bei ihrer Verarbeitung zu senken sowie die Marginalität zu erhöhen. Die Kohleindustrie steht vor der Aufgabe, die Produktionskette vom Abbau bis zur Bereitstellung der Rohstoffe beim Verbraucher zu optimieren.
In der Elektrizitätswirtschaft konzentriert sich die digitale Transformation auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung, die Begrenzung des Anstiegs der Strompreise sowie die Entwicklung neuer Dienste und Formate für die Interaktion mit Verbrauchern.
Generell sind in der Rohstoffindustrie die Kosten der Organisationen für die Einführung digitaler Technologien noch gering (2,2 Prozent der Gesamtkosten) und für die digitale Transformation aller Wertschöpfungsstufen eindeutig unzureichend. Dies liegt an der hohen Kapitalintensität von Projekten, langen Innovationszyklen und langen Amortisationszeiten für technologische Innovationen.

Infografik „RG“ / Leonid Kuleshov / Alena Uzbekova
Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit der Beherrschung digitaler Technologien innerhalb der Branche unterschiedlich: Der Öl- und Gassektor setzt sie aktiver um.
Mittlerweile werden Technologien zur Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Big Data am stärksten in der Rohstoffindustrie eingesetzt (21,8 Prozent). Fast jede fünfte Organisation nutzt auch Cloud-Dienste (19 Prozent) und Geoinformationssysteme (GIS) (18,8 Prozent). Der hohe Nutzungsgrad von GIS ist darauf zurückzuführen, dass die mit ihrer Hilfe gewonnenen räumlichen Daten zur Lösung von Problemen der Planung, Feldentwicklung, Ausrüstung und Steuerung von Industrieanlagen erforderlich sind. Die relativ bescheidene Durchdringung des Internets der Dinge (14,6 Prozent der Organisationen) ist auf die Komplexität der Interoperabilität einer großen Anzahl von physischen Assets und Softwarelösungen zurückzuführen.
Technologien der künstlichen Intelligenz werden noch von wenigen Akteuren genutzt, haben aber ein großes Potenzial. Auf maschinellem Lernen basierende Systeme ermöglichen es beispielsweise, seismische und geologische Daten zu analysieren, darauf aufbauend Modelle für Entscheidungen über die Ausbeutung von Lagerstätten zu erstellen und verschiedene Gesteinseigenschaften zu bestimmen.
„Digitale Zwillinge“ und Robotertechnologien gewinnen in der Bergbauindustrie allmählich an Popularität.Der nächste Schritt ist der Übergang zu Industrie 5.0 mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung und Menschen
In der Fertigungsindustrie werden digitale Technologien aktiver eingeführt – gemessen an der Höhe der Kosten für die Einführung digitaler Technologien (9,2 Prozent) belegt die Branche den zweiten Platz hinter der Finanzdienstleistungsbranche. Allerdings entsprechen nur etwa 12 Prozent der produzierenden Unternehmen dem Bild der modernen digitalen Fertigung. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich die Auswirkungen von Investitionen in diesem Sektor verzögern und zeigen werden, wenn Unternehmen von Pilotstarts zu einer umfassenden Implementierung digitaler Lösungen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette übergehen.
Nun stehen viele Organisationen der Branche am Anfang der digitalen Transformation und bauen nach und nach heterogene Datenmanagementsysteme als Grundlage für die Prozessoptimierung auf (26,5 Prozent der Unternehmen nutzen Technologien zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Big Data). Dies geschieht zunehmend in der Cloud und erfordert hohe Standards für den Schutz der Datenübertragung (27,1 Prozent nutzen Cloud-Dienste).
In allen Branchen haben Lösungen an der Schnittstelle mehrerer Bereiche große Perspektiven, zum Beispiel Systeme, die auf „digitalen Zwillingen“ basieren, die Elemente der künstlichen Intelligenz, des Internets der Dinge, drahtloser Kommunikationstechnologien und Sensoren enthalten. Das jährliche Wachstum dieses Marktes in der Zukunft bis 2026 wird voraussichtlich mehr als 50 Prozent betragen.
Der nächste Schritt wird der Übergang zu Industrie 5.0 sein, die sich neben der Einführung fortschrittlicher Technologien in Produktionsprozesse auf nachhaltige Entwicklung und auf den Menschen ausgerichtete Technologien konzentriert. Nach Japan, das bereits 2016 den Übergang zur Society 5.0 ankündigte, strebt auch die Europäische Union nach und nach dieses Modell an.
In Russland wird die Entwicklung menschenzentrierter Technologien jetzt in dem 2020 gegründeten wissenschaftlichen Zentrum von Weltrang „Zentrum für interdisziplinäre Studien des menschlichen Potenzials“ angegangen.
Konstantin Vishnevsky (Direktor des Center for Digital Economy Research, ISSEK, National Research University Higher School of Economics)